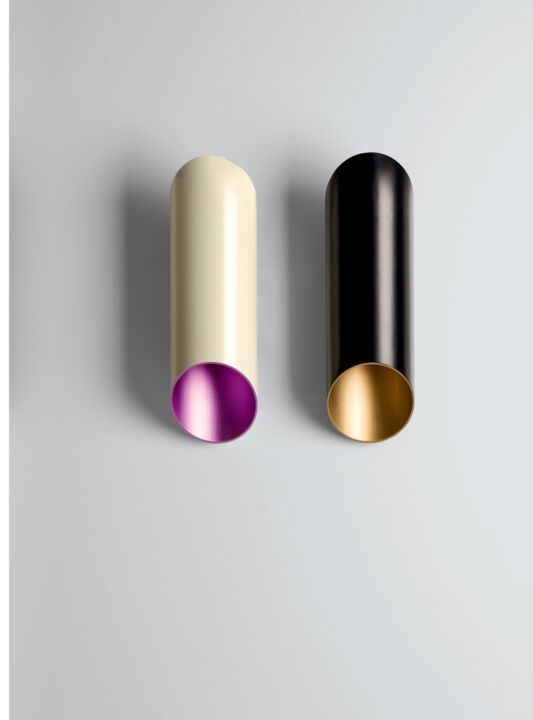AW Designer des Jahres 2008: Tom Dixon
Wer weiß, was heute von Tom Dixon zu hören wäre, hätte er damals im Jahr 1982 auf seinem Motorrad nicht nach der hübschen Lady am Straßenrand geschielt. Der Bruchteil einer Sekunde Unaufmerksamkeit hat den damals 23-Jährigen vielleicht eine Weltkarriere als Pop-Musiker gekostet. Er verlor das Gleichgewicht und schrammte mit seiner BMW RS69S über den Asphalt. Nach dem Crash war an Bassspielen nicht zu denken.
Der Arm war gebrochen. Die anderen Bandmitglieder mussten für die anstehende Tournee kurzfristig Ersatz suchen. „Leider spielte der besser als ich“, gibt Dixon zu. Kein Wunder, dass die „Funkapolitans“ das Ursprungsmitglied auch mit auskuriertem Arm nicht wieder zurück haben wollten. Dixons Musikerkarriere war beendet, bevor sie richtig begonnen hatte. Andererseits: ein Glück für die Designwelt.


2. Der Spassfaktor
Dixon jobbte, nachdem die Blessuren verheilt waren, in der Londoner Nightclubszene, er wurde Veranstalter von angesagten Partys in den ausgedienten Lagerhäusern. Wieder ein Glücksfall für das Design. Denn tagsüber hatte er viel Zeit, die er irgendwie totschlagen musste. Das tat er, indem er in der Ga- rage eines Freundes an Motorrädern herumschraubte. Nebenbei sammelte er Schrott, den er in der Werkstatt zu Objekten zusammenschweißte. Just for fun. Mit dem reinen Spaß war es vorbei, als Dixon merkte, dass Leute bereit waren, für seine Kreationen Geld auszugeben. Von da an verschrieb er sich der Designerlaufbahn.
3. Der Deal
„Mich interessiert sehr die kommerzielle Seite des Designs“, erklärt Tom Dixon. „Es hat mich fasziniert, aus den Sachen, die ich auf der Straße gefunden und zusammengeschweißt habe, Geld machen zu können. Ich kam mir vor wie ein Alchemist, der Metall in Gold verwandelt. Mich interessiert am Design eben nicht nur die Formgebung, sondern der gesamte Prozess: die Idee, die Fertigung, die Logistik, die Distribution.“


4. Die S-Kurve
Es dauerte nicht lang, bis der für seine Spürnase berühmte italienische Designunternehmer Giulio Cappellini auf den jungen Kreativen aufmerksam wurde und ihm erste Aufträge gab. Mit Entwürfen für Cappellini und Moroso, eine weitere italienische Avantgardemanufaktur, erlangte Dixon schnell internationale Aufmerksamkeit. Es entstanden das Systemsofa „Serpentine“, die einprägsame Chaiselongue „Bird“, die Stuhlskulptur „Pylon“, die sich am Konstruktionsprinzip von Brückenträgern orientiert –, und sein wohl bekanntestes Objekt, der ursprünglich mit Stroh bezogene „S-Chair“, der eher zum Bestaunen als zum Besitzen geeignet ist. Doch der „S-Chair“ wurde zur Ikone des 90er-Jahre-Designs. Und Tom Dixon hatte den Aufstieg in die A-Liga des Designs geschafft.

5. Die Firma
Tom Dixon ist eine lässige Erscheinung: groß, immer ein wenig unfrisiert, zum Interview erscheint er in einem braun-grünen Anzug, Hemdkragen über dem Revers, spitze Schuhe, very british, very stylish. Sein Studio hat er seit drei Jahren in zwei Etagen einer alten Filmprojektorfabrik im Londoner Citybezirk Holborn. 22 festangestellte Mitarbeiter arbeiten emsig für die Kollektion „Tom Dixon“; zwei, drei Männer, sonst nur junge Ladys.
6. Das Google-Prinzip
Seit 2006 erregt Tom Dixon jeden Oktober enormes Aufsehen mit einem Event zur Londoner Design Week. Er stellt für eine Woche Sessel oder Leuchten in riesiger Stückzahl am Trafalgar Square aus, um sie dann am letzten Tag publikumswirksam zu verschenken. Es steckt aber mehr hinter diesen Aktionen als Eigen-PR: „Ich stelle mir das vor wie bei Google. Du gibst alles umsonst weg und machst dein Geld durch Werbung. Ich werde bei solchen Aktionen von einem Sponsor bezahlt, nicht von Kunden.“ Hört sich clever an, aber wie genau soll das funktionieren? Tom Dixon lehnt sich zurück, verschränkt die Arme hinter dem Kopf, wie jemand, der ein Full house auf der Hand und noch ein Ass im Ärmel hat, und lässt seine gut 1,90 Meter so tief in den Stuhl rutschen, dass Lümmeln eine vornehme Beschreibung wäre. „Nehmen wir an, du bist eine Bank und möchtest deinen Namen bekannt machen. Du kannst viel Geld in Fernsehwerbung investieren. Die Spots dauern 30 Sekunden, dann bist du vergessen.“ Kunstpause. „Oder ich sage dir: Hey, ich entwerfe einen Stuhl, den bringe ich mit deinem Logo drauf in die Häuser. Der steht da zwei, drei Jahre lang, und die Leute sehen jeden Tag dein Logo. Und wenn sie eine Bank brauchen, kommt ihnen dein Name ganz vertraut vor.“

7. Der Gewinn
Für den Designer hat das nur Vorteile. Dixon richtet sich wieder auf. „Normalerweise läuft es doch so. Ein Designer hat eine Idee für einen Plastikstuhl. Er geht zu einem Plastikmöbelspezialisten, sagen wir zum Italiener Magis. Magis sagt ja-nein-vielleicht, nach einigem Hin und Her entsteht zwei Jahre später ein Prototyp. Wieder ein halbes Jahr später wird entschieden, welche Farbe er haben soll, er wird in China produziert, wird nach Italien geschifft, kommt ins Lager und wartet da auf Käufer. Vielleicht sogar aus China. Da habe ich es viel einfacher: Bei meinem Modell kommen die Stühle direkt aus der Fabrik zu einem breiten Publikum. In zehn Minuten bringe ich 200 Stühle an den Mann.“ Sehr effizient: kein Lager, kein Vertrieb, und der Designer hat auf schnellstmöglichem Weg seine Investitionen wieder reingeholt. Weil der Sponsor ja alles auf einmal bezahlt. Auch Streuverluste fürchtet Dixon nicht. Man muss nur die passenden Events für das Produkt aussuchen, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. „Vielleicht“, sinniert Dixon, „mache ich das eines Tages mit all meinen Produkten.“ Zufrieden gleitet er wieder in die Fasthorizontale.
"Ich wollte etwas ganz Simples, möglichst Unsichtbares entwerfen. Heraus kam der ,Mirror Ball‘, eine verspiegelte Kugel als Lampenschirm. Sie ist ungefähr so unscheinbar wie die Sonnenbrillen, die Paris Hilton trägt."
8. Die Übernahme
Bleiben wir beim Geschäft: Nur durchs Verschenken verdient auch Tom Dixon kein Geld. Das Konzept des Unternehmens Tom Dixon beinhaltet die Verankerung in einem größeren Ganzen. „Ich gehöre dem schwedischen Investment-Unternehmen Proventus.“ Das ist nun 100-prozentiger Eigentümer von Dixons Firma Design Research, zu der wiederum das Label „Tom Dixon“ und seit Kurzem die finnische, 1935 von Alvar Aalto gegründete Traditionsmarke Artek gehören. So hat Dixon die Möglichkeit zweigleisig zu arbeiten. „Artek ist die strenge klassische Schiene, Tom Dixon ist jünger, moderner, modischer, leichter. Ich mag beides. Aber mit zwei Firmen kann ich als Geschäftsführer für jede ein schlüssiges Portfolio erarbeiten.“


9. Die Theorie
Es soll dies nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Design-Imperium sein. Tom Dixons Ziel: weitere Firmen integrieren, um die Infrastruktur noch stärker zu verbessern. Synergieeffekte nutzen, nennt man das wohl heute. Aber Tom Dixon geht es auch noch um einen anderen wichtigen Aspekt. „Designer haben sehr wenig Einfluss in einem Unternehmen“, sagt der ehemalige Creative Director der Möbelmarke Habitat. „Die Designidee kommt oft nicht zum Zuge.“ Sein Körper nimmt wieder Spannung an. „Ich teste folgende Theorie: Wenn Design auf Eigentümerebene Bedeutung hat, zum Beispiel, weil der Eigentümer Designer ist, dann bekommst du bessere Ergebnisse.“ Während man in Gedanken mögliche Präzedenzfälle durchgeht, vertröstet Dixon. „Ob das funktioniert, erzähle ich dir in ein paar Jahren.“
10. Das Unsichtbare
Was ihn antreibt, ist Langeweile. Sagt er. Er nennt es „eternal dissatisfaction“, seine ewige Unzufriedenheit, die ihn dazu bringt, seine Produkte laufend zu verändern. „Ich war nach meinen Jahren bei Habitat krank von Design. Ich habe in sieben Jahren 600 Objekte begutachtet. Wir haben jedes Jahr 40 Prozent der Produktpalette ausgetauscht.“ Also schwebte ihm für sein neuestes Produkt ein Anti-Design vor, etwas nahezu Unsichtbares, jedenfalls Unauffälliges. Entstanden ist die Hängeleuchte „Mirror Ball“, eine reflektierende Silberkugel mit 40 Zentimeter Durchmesser, die alles andere als unsichtbar ist. „Sie ist ungefähr so unscheinbar wie die riesigen Sonnenbrillen, die Paris Hilton trägt.“ Gesteht Dixon und schmunzelt über seinen ursprünglichen Plan. „Das Resultat ist das Gegenteil der Idee: Die Leuchte ist wie ein Statussymbol.“


11. Das Engagement
Für seine Give-away-Aktion am Trafalgar Square hat Tom Dixon Hunderte von Leuchten kreiert und inszeniert, die nur mit Energiesparlampen betrieben werden können. Wie wichtig ist der ökologische Aspekt im Design? „Er wird immer bedeutender. Eigentlich.“ Aber auf den Messen in Mailand und Köln letztes Jahr hat er nicht besonders viel ökologisches Design gesehen, findet Dixon. Jedenfalls nicht genug. „Die Studenten kümmern sich darum, die Industrie nicht.“ Ein wenig desillusioniert ihn, dass die Szene aktuell mehr an Kunstmöbeln als an ökologischem Design interessiert ist. Auch sein unbequemer „S-Chair“ erreicht auf Designauktionen vierstellige Beträge. „Wie professionell ist das, seinen Kopf in den Sand zu stecken?“
12. Die Familie
Neulich war Tom Dixon zu Besuch auf der Chinese Product Fair. Ein Horror- trip! Die dunkle Seite des Designs. Unmengen von nutzlosem Kram. „Wie in den Zimmern meiner Töchter“, sagt er und verdreht die Augen. Die sind 15 und 12. „Hard work.“ Aber Dixon ist Daddy Cool. Er ist die meiste Zeit im Studio oder auf Geschäftsreisen. Zu Hause regiert seine Lebensgefährtin. Verheiratet ist er „not exactly“.


13. Die Kraft
Was sind seine Stärken, welches seine Schwächen? „Meine Schwächen sind meine Stärke“, sprudelt es aus ihm heraus. Er ist kein Experte für irgend- was, er hat ja auch nichts gelernt. Der überzeugte Autodidakt. „Die einzige Qualifikation, die ich habe, ist ein Töpferkurs. In der Schule.“ Tom Dixon ist sich ganz sicher, dass es auch Vorteile haben kann, wenn man sich nicht so gut auskennt in einem Gebiet. „Wenn einem die Materie zu bekannt ist, fängt man schnell an, sich zu wiederholen. Ich bin am besten, wenn ich nicht so gut bin.“ Sagt’s, setzt seinen weißen Helm mit rotem Stern auf der Stirn auf, besteigt seine Moto Guzzi und schlängelt sich durch den dichten Londoner Feierabendverkehr.